02.04.2025

Gerade die Corona-Krise hat den Wert einer funktionierenden heimischen Landwirtschaft, welche die Grundversorgung der Bevölkerung auch in Krisenzeiten sicherstellen kann, deutlich vor Augen geführt. Die Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit von fremden Einflüssen sind gerade in überlebenswichtigen Bereichen wie der Ernährung der Bevölkerung unverzichtbar. Durch einen brutalen internationalen Preiskampf steht die heimische Landwirtschaft, die höchste Umwelt-, Tierschutz- und Qualitätsstandards erfüllt, unter Druck. Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung der Lebensmittel in Gastronomie und Großküchen ist daher das Gebot der Stunde.
Den meisten von uns ist der Schutz der Umwelt ein Anliegen und wir sind – nicht erst seit Greta – für Klimaschutz. Niemand will, dass Tiere gequält werden, und alle befürworten Nachhaltigkeit. Wir schätzen eine saubere, gut instandgehaltene und gepflegte Kulturlandschaft als Lebens- und Erholungsraum. Wir erwarten und vertrauen darauf, dass wir auch in Krisenzeiten mit dem Überlebensnotwendigen sicher und verlässlich versorgt werden. Niemand mag sich vorstellen, dass bei der nächs-ten Corona- oder sonstigen Krise unsere Politiker am Flughafen stehen und händeringend auf ein Flugzeug voll Essen aus China warten. So weit, so gut.
Dazu können und müssen wir aber auch selbst beitragen. Wir können bewusst leben, Müll vermeiden, Wertstoffe recyclen, öffentliche Verkehrsmittel benutzen und bewusst konsumieren. Wie wir unser Geld ausgeben, hat unmittelbaren Einfluss auf unser Umfeld und unsere Umwelt. Was und wie ich einkaufe, entscheidet, wie auf der Welt gewirtschaftet wird. Mit meinem Einkaufsverhalten bestimme ich, ob es Käfighaltung für Hühner oder eine Berglandwirtschaft gibt. Mit dieser Macht hat jeder Konsument auch große Verantwortung. Im Supermarkt sieht jeder Mensch, woher die Lebensmittel stammen, und trifft auf dieser Basis seine Kaufentscheidung. Warum wohl setzen inzwischen alle Handelsketten bei Frischfleisch fast ausschließlich auf österreichische Ware? Weil es der Konsument so will. Wer zahlt, schafft an.
Nicht so in der Gemeinschaftsverpflegung und in der Gastronomie. In Krankenhäusern, Betriebskantinen, Restaurants und Lokalen wird dem Konsumenten diese Entscheidungsfreiheit großteils verwehrt. In Österreich wird jedes zweite Mittagessen inzwischen außer Haus eingenommen. Die Hälfte des Fleisches im Außerhausverzehr kommt aus dem Ausland. Friss oder lass es bleiben, scheint hier das Motto zu sein. Ohne es zu wissen und vielfach auch ohne es zu wollen, essen viele Konsumenten importierte Lebensmittel. Daher führt an einer verpflichtenden Herkunftskennzeichnung, zumindest für die tierischen Hauptlebensmittel Fleisch, Milch und Eier, kein Weg vorbei. Der Mensch hat nicht die Pflicht, regionale Produkte zu essen. Aber er muss das Recht zur Auswahl haben. 75 Prozent der Bevölkerung wollen nach aktuellen Umfragen eine ehrliche und nachvollziehbare Lebensmittelkennzeichnung.
Regional oder egal?
Es ist nicht egal, woher unser Essen kommt. Tatsächlich spielt es eine entscheidende Rolle, woher die Produkte stammen, die ich esse. Nicht nur wegen der Qualität oder der Wertigkeit des Produktes an sich, sondern wegen vieler Faktoren, die damit zusammenhängen. Eine sehr gute Fleischqualität aus Österreich und eine sehr gute Fleischqualität z. B. aus Argentinien kann man nicht direkt vergleichen, ohne nicht auch die weiteren Auswirkungen, etwa hinsichtlich Umweltstandards, Tierschutz, regionale Wertschöpfung oder CO2-Fußabdruck zu betrachten. Selbst wenn ein Steak aus den USA gleich gut schmecken sollte wie das vom Grauviehalmochsen aus dem Wipptal, trägt es doch einen ganz anderen ökologischen und tierethischen Rucksack mit sich herum. Vielleicht kann eine Laboruntersuchung keinen Unterschied zwischen einem Ei aus ukrainischer Käfighaltung und einem aus österreichischer Freilandhaltung feststellen. Trotzdem liegen Welten dazwischen und es muss dem Konsumenten zugestanden werden, sein hart verdientes Geld bewusst für die eine oder die andere Form der Landwirtschaft auszugeben.
Was spricht für regionale Lebensmittel?
Auch importierte Lebensmittel können von höchster Qualität und Güte sein. Regionale Lebensmittel aus Österreich aber haben einen zusätzlichen Mehrwert. Nur mit dem Kauf österreichischer Lebensmittel bekommt der Kunde das Gesamtpaket:
Regionalität und Wertschöpfung
Regionalität bringt Leben in die Regionen. Regionale Wirtschaftskreisläufe belassen das Geld in der Region. Damit wird wieder in regionale Betriebe investiert. Der Bauer kauft regional im Lagerhaus, beauftragt für den Stallbau eine heimische Baufirma. Die Region bleibt am Leben, wenn kleine Wirtschaftskreisläufe funktionieren. Letztendlich bleibt auch das Steuergeld in der Region. Wertschöpfung fließt nicht ins Ausland ab. Regionalität sichert heimische Arbeitsplätze. Wenn im Tiroler Tourismus 57 Prozent der Mitarbeiter Ausländer sind (TT vom 29.07.2020), in der Außer-Haus-Verpflegung mehr als 50 Prozent des Fleisches aus dem Ausland kommt und die Gewinnspanne vermehrt an auswärtige Investoren als Betreiber der Betriebe fließt, dann reduziert sich der volkswirtschaftliche Nutzen des Tourismus massiv. Und dann könnte auch bald die Tourismusgesinnung der ansässigen Bevölkerung ins Negative kippen. Da würde eine positive Identifizierung, ein Bekenntnis zum regionalen Produkt sicherlich eine Verankerung und Verwurzelung in der Region bringen.
Regionalität und Landschaftspflege
Es sind weder der Gaucho aus Argentinien noch der Cowboy aus Amerika und auch nicht der Schweinemäster aus Dänemark, die unsere österreichische Kulturlandschaft pflegen und so einzigartig erhalten und sorgsam auf unseren Lebensraum achten. Unsere Bäuerinnen und Bauern sind es mit ihrer täglichen, oft harten Arbeit. Nur wenn das Produkt, das mit der Bewirtschaftung des Landes entsteht, auch verkauft wird, wird die Arbeit weiterhin getan. Gerade Touristiker, die in starkem Ausmaß von der Arbeit der Bauern mitpartizipieren, tun gut daran, auch etwas zurückzugeben, indem die Früchte, die die Landschaftspflege bedingen und verursachen, auch abgenommen werden – zu einem fairen Preis.
Mittelfristig sichert die Regionalität die Bereitschaft der Bauern, ihr Eigentum weiterhin für Tourismus und Freizeitwirtschaft zur Verfügung zu stellen, damit andere es nutzen und daran verdienen können. Es ist keine nachhaltige Wirtschaftsweise, wenn ein Hotelier seine Gäste zum Wandern auf die heimische Alm schickt, ihnen zum Abendessen aber billigstes Weltmarktschwein von irgendwo serviert.
Regionalität und Klimaschutz
Regionalität heißt kleine Wirtschaftskreisläufe, heißt kurze Transportwege, heißt Überschaubarkeit. Weniger Transportkilometer heißt weniger CO2-Ausstoß, heißt weniger Erderwärmung, heißt weniger Klimabelastung. In Deutschland z. B. kommen vier Prozent aller Lebensmittel aus Übersee. Die Wegstrecken, die diese vier Prozent zurücklegen, machen im Vergleich mit allen Lebensmitteln über zwei Drittel aus. Ware aus Übersee wird größtenteils mit dem Schiff transportiert. Die Importware verbraucht elfmal mehr Energie, stößt elfmal mehr CO2 aus und verbraucht 28-mal so viel Schwefeldioxid wie einheimische Produkte. Das Flugzeug ist ein noch viel größerer Klimakiller. Ein Kilo Lebensmittel, das per Luftfracht transportiert wird, verursacht so viele Emissionen wie 90 Kilo Lebensmittel, die innerhalb Österreichs transportiert werden. Der im Zuge der „Fridays for Future" entstandene Begriff der „Flugscham" gilt nicht nur für Urlaubsreisen, sondern müsste noch viel mehr für Frachtflüge gelten. Brauchen wir in Österreich Obst aus Neuseeland, Trauben aus Südafrika oder Fleisch aus Botswana?
Regionalität und Umweltschutz
Durch weniger Straßentransport gibt es weniger Feinstaubbelastung. Gerade im transitgeplagten Österreich sollte das jedem bewusst sein. Die österreichische Landwirtschaft mit ihrem Umweltprogramm ist europaweit mustergültig. Selbst die größten Kritiker werden zugeben müssen, dass in keinem anderen entwickelten Land derart sorgsam mit der Natur und Umwelt umgegangen wird wie in Österreichs Landwirtschaft.
Regionalität und Nachhaltigkeit
Nachhaltig sind Lebens- und Wirtschaftskreisläufe dann, wenn die dauerhaft angelegt sind, nicht auf Ausbeutung, Raubbau und Ressourcenverschwendung. Nachhaltigkeit heißt geben und nehmen. Regionalität sichert die Nachhaltigkeit der heimischen Landwirtschaft, weil diese in den regionalen Abnehmern Antriebsfedern für die weitere Bewirtschaftung findet: Wir können dauerhaft die Ergebnisse eures Wirkens genießen, weil wir euch die Früchte eurer Arbeit abnehmen.
Regionalität und Krisensicherheit
Die Coronakrise mit ihren Grenzschließungen hat uns brutal vor Augen geführt, wie abhängig wir sind und wo die Grenzen der Globalisierung liegen. Globale Arbeitsteilung kann in gewissen Bereichen Vorteile bringen. Bei strategischen, also lebenswichtigen Gütern wie Lebensmitteln muss aber die Autonomie, die Unabhängigkeit, die Sicherheit auch im Krisenfall gewährleistet sein. Wir dürfen unser Schicksal nicht in die Hände fremder Nationen legen, weil im absoluten Notfall jenen das eigene Hemd auch näher sein wird als der fremde Rock. Wir können ohne Autos, ohne Kultur, ohne Fernsehen, sogar ohne Handy überleben – wie die Geschichte der Menschheit über Jahrtausende bewiesen hat – aber wir können nicht ohne Essen überleben. Wenn das Bauernsterben so weiter geht, ist die Fähigkeit zur Selbstversorgung in einigen Jahren nicht mehr gegeben. Die Instabilität der internationalen Verlässlichkeit zeigt sich auch in den Wahlergebnissen in verschiedenen Ländern, wo unberechenbare Despoten und Chaoten wie Donald Trump oder Jair Bolsonaro an die Oberfläche gespült werden.
Regionalität und Tierschutz
Österreich hat eines der strengsten Tierschutzgesetze der Welt. Konsumenten, die österreichische Produkte essen, können sich darauf verlassen, dass die Lebensmittel unter strengen Auflagen produziert wurden und dass kein Tier unnötiges Leid erdulden musste. Regionale Verwendung der Lebensmittel heißt, dass weniger Transporte ins Ausland erfolgen. Es kann aber nicht sein, dass wir die heimischen Bauern unter das Joch strenger Auflagen zwingen und stattdessen Auslandsware kaufen, die eben genau diese Regelungen nicht einhalten braucht. Nach Österreich werden jährlich 236 Millionen Eier meist fragwürdiger Herkunft in Form von Flüssigei, Trockenei und Schalenei eingeführt. Weil sie kein Mascherl tragen, landen sie dann versteckt in Kuchen, Nudeln, Backwaren, aber auch in der Gastronomie. Höchstwahrscheinlich sind die Eier aus der Ukraine, die nach Österreich geliefert werden, nicht giftig. Aber sie stammen aus Käfighaltung, die bei uns lange verboten ist. Regionalität heißt kleine Kreisläufe von Aufzucht bis Schlachtung und Verbrauch. Wo Herkunft deklariert wird, gilt auch Tierschutz.
Für ein paar Cent mehr ...
Viele Gründe sprechen für die Verwendung heimischer Produkte. Dennoch sträubt sich Österreichs Paradebranche, die Gastronomie nämlich, seit Jahren gegen eine Kennzeichnungspflicht, wie sie die Schweiz längst flächendeckend implementiert hat. Der Grund ist einfach: Österreichische Produktionsstandards vor allem bei tierischen Produkten schlagen sich auf den Preis nieder. Auf die fertige einzelne Portion umgerechnet sind die Preisunterschiede zwischen österreichischem und dem billigsten Importfleisch zwar lächerlich gering: beim Schwein sind es läppische zehn Cent und beim Rind 20 Cent. Und selbst bei Huhn und Pute macht der Unterschied gerade einmal 50 bzw. 70 Cent pro Essen im Gasthaus aus. Trotzdem blockieren die Vertreter der Gastronomen den Wunsch der Konsumenten nach Herkunftskennzeichnung. Sie ignorieren deren Bereitschaft, zur heimischen Qualität zu greifen (obwohl es in den Supermärkten eindrucksvoll bewiesen wird). Stattdessen spielen sie den billigen Jakob. Die Produkte müssen nicht aus der Region kommen, es reicht, wenn der Gast das glaubt. Unterschwellig suggeriert durch die Lage des Hotels inmitten der gepflegten Kulturlandschaft, die rustikale Wirtshauseinrichtung oder die Kellnerin im Dirndl. Dass auf den Tellern der österreichischen Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung hunderttausende Tonnen Importfleisch landen, wird verschwiegen oder versteckt, bewusst oder unbewusst. Die ausländischen Produkte landen dort, wo man sie nicht erkennt.
Seefelder Wildragout (Herkunft Ungarn) mit Eierschwammerl, Innsbrucker Gröstl aus Deutschland und kroatische Schnitzelsemmel im Tirol-Berg: Was bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz wie ein Skandal dahergekommen ist, fliegt in Österreich im Normalfall also gar nicht auf, sondern geht als alltägliche Praxis unbemerkt am Konsumenten vorbei. Dabei würde eine ehrliche und nachvollziehbare Kennzeichnung einen Mehrwert für die Bewerbung bieten, wenn das kommuniziert wird. Wer heimische Produkte verwendet, bekommt einen Wettbewerbsvorteil.
Kennzeichnung ist machbar
Die Argumente der Gegner einer Lebensmittelkennzeichnung sind leicht zu widerlegen. Als erstes werden der gigantische bürokratische Aufwand und die Unmöglichkeit der Kontrollen genannt. Es sei unmöglich, von jedem Schnitzel das dazugehörige Kalb und den Bauernhof zu benennen. Dann wird festgestellt, dass die heimische Landwirtschaft die benötigten Mengen ja gar nicht liefern kann. Danach wird auf den Küchenchef oder den Gastrogroßhändler verwiesen, den man nicht im Griff hat. Ein Tiroler Hoteliervertreter meint, man nehme mit einer generellen Kennzeichnungspflicht denjenigen Betrieben, die bisher schon ausgezeichnet haben, ihr Alleinstellungsmerkmal, ihren USP. Schließlich wird auf die bürokratische Belastung durch Allergenkennzeichnung, Rauchverbot und dergleichen verwiesen und auf die Belastung durch Corona. Am schwierigsten zu widerlegen ist freilich das Argument des obersten Wirtevertreters in der Wirtschaftskammer Österreich in einer ORF-Dokumentation: „Weil es mich einfach nicht interessiert!"
Es braucht keine Trittbrettfahrer
Hier gilt es abzuwägen, ob die persönliche Befindlichkeit eines „Gastronoven" schwerer wiegt als der Wunsch von drei Viertel der Bevölkerung. Die bessere Hälfte der Gastronomie kann mit der Herkunftskennzeichnung sicher umgehen. Die schlechtere Hälfte darf die Gesellschaft auf Dauer nicht in Geiselhaft nehmen. Die Kennzeichnungspflicht mag eine Gefahr für bestimmte Betriebe sein – für die Tarner und Täuscher – sie ist aber eine Chance für alle, weil die österreichische Landwirtschaft die Vorarbeiten dazu bravourös gemeistert hat und absolute Premiumprodukte mit Mehrwert anbietet.
Die Corona-Belastungen, das Rauchverbot und die Allergenverordnung werden ebenfalls oft als Hindernisgrund genannt. Corona hat alle Branchen getroffen, nicht nur die Gastronomie. Gerade für die Gastronomie bietet ein ehrlicher Umgang und Transparenz aber mehr Chancen als Gefahren, um sich nachhaltig zu positionieren. Eine beträchtliche Anzahl der Betriebe, die die Krise wirtschaftlich nicht überleben werden, werden das mit und ohne Kennzeichnung nicht tun. Das sind diejenigen, die auch bisher schon an der Kante dahingeschrammt sind. Mit einer allgemeinen Kennzeichnungspflicht nimmt man kein Alleinstellungsmerkmal, im Gegenteil. Man nimmt den Trittbrettfahrern den Schutz der Anonymität der Produkte. Man schafft Waffengleichheit zwischen den Betrieben. Verlangt wird nur eine Mindestkennzeichnung, nach oben stehen freiwillig selbstverständlich alle Möglichkeiten offen. Wer will, kann gerne den einzelnen Bauernhof angeben, muss aber nicht.
Unsere Region heißt Österreich
Unser Ziel ist kein aufgeblähter Bürokratismus. Es ist nicht notwendig, auf der Speisekarte jeden einzelnen Lieferanten anzuführen. Die Angabe des Herkunftslandes (Österreich) genügt im Prinzip. In ganz Österreich gelten die gleichen Produktionsstandards und Haltungsanforderungen. Die Region Österreich bedeutet einheitliche/gleiche Qualitätskriterien, gesetzliche Vorschriften und Tierschutzstandards. Regionalität auf Österreich bezogen sichert meine Steuergelder.
Damit wäre der bürokratische Aufwand für einen Betrieb, der sich zu Österreich bekennt, eigentlich schon erledigt. Er schreibt einmal „Herkunft: Österreich" in die Karte und es hat sich eigentlich. Dazu kommt die unmissverständliche Anweisung an den Gast-rogroßhändler, bei Interesse an Fortführung der Geschäftsbeziehung künftig ausschließlich österreichisches Fleisch und Milchprodukte zu liefern. Missbrauch und Etikettenschwindel darf allerdings nicht als Kavaliersdelikt gesehen werden. Wer trickst und täuscht, ist mit voller Härte zu bestrafen.
Regionalität nicht zu eng denken
Nicht alles kann überall erzeugt werden, daher darf Regionalität nicht zu eng definiert werden. Unsere Region ist Österreich. Tirol ist aufgrund der Topografie und des Klimas hauptsächlich Dauergrünlandgebiet, das nur über den Wiederkäuermagen verwertet werden kann. Die Nichtverfügbarkeit von bestimmten Produktgruppen in Tirol oder gar in einzelnen Talschaften darf nicht dazu führen, sich von der Regionalität zu verabschieden und die Produkte – eben weil ich sie gleich ums Eck nicht bekomme – gleich am Weltmarkt zu beziehen. So nach dem Motto „Ich würd eh, aber die anderen können nicht liefern ....". Zu eng gedachte Regionalität darf nicht dazu führen, dass sich Wirte und Köche von der regionalen Verantwortung verabschieden.
Leitprodukte aus der Region verwenden
Österreich ist in allen maßgeblichen Produktgruppen Selbstversorger bzw. kann es durch die Herkunftskennzeichnung werden. Bei Bier, Getreide, Erdäpfeln, Äpfeln, Karotten, Rind und Kalb, Schwein, Eiern, Konsummilch, Obers, Rahm und Käse liegt der Selbstversorgungsgrad bei jeweils über 85 Prozent.
Für jedes Gebiet gibt es landwirtschaftliche Leitprodukte. Für Tirol z. B. Rind- und Kalbfleisch, Milch und Milchprodukte, Käse, Kartoffeln und Gemüse. Diese Produktgruppen sollen nach Möglichkeit aus der engeren Region bzw. dem Bundesland bezogen werden. Unsere Leitprodukte dürfen nicht wegen ein paar Cent vermeintlichem Gewinn um den halben Globus gekarrt werden. Andere Produkte wie Schweinefleisch sind nach Möglichkeit aus Österreich zu beziehen.
Ja zu A
Mit der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung auf dem Teller gibt man sowohl den Konsumenten und Gästen als auch den Bäuerinnen und Bauern eine faire Chance in der Auswahl der Lebensmittel und der Entscheidung über die Entwicklung der zukünftigen Versorgungssicherheit. Der Konsument soll entscheiden dürfen, ob er mit seinem Geld Feedlots in Amerika mit hunderttausenden Rindern unterstützt.
Es gibt freiwillige Initiativen und zahlreiche Wirte, die den Vorteil einer Herkunftskennzeichnung erkannt haben. Wenn es so sein sollte, dass die amerikanische Systemgastronomie McDonalds die einzige ist, bei der ich garantiert nur Rindfleisch aus Österreich bekomme, dann weiß ich nicht, warum ich zum Dorfwirt gehen sollte. Eine Initiative „Tiroler Wirtshauskultur", die zwar ein rustikales Ambiente und Gerichte mit regionalen Rezepten vorschreibt, wo aber die Herkunft der Lebensmittel völlig egal ist, kann mir persönlich gestohlen bleiben.
An Kennzeichnung führt kein Weg vorbei
An einer ehrlichen Deklaration der Lebensmittelherkunft führt kein Weg vorbei. Die Wirtschaft war selbst ein Vorreiter der Herkunftskennzeichnung. Ältere erinnern sich noch an die Fernsehsendung „Made in Austria" mit Günter Tolar im ORF, wo mit massiver Unterstützung der Wirtschaftskammer das „Ja zu A" beworben wurde. Auf jedem Industrieprodukt, und sei es noch so ein Plastikglump, steht, wo es hergestellt wurde. Daher ist es unverständlich, wenn gerade die Wirtschaft Widerstand signalisiert.
Natürlich ist uns klar, dass wir unseren Partnern im Tourismus mit einer Herkunftskennzeichnung allerhand zumuten. Wenn es aber Partner sind, dann erkennen sie den beiderseitigen Nutzen. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass im Tourismus mehr Ehrlichkeit und Nachhaltigkeit eingefordert wurde. Die Kennzeichnung der Lebensmittelherkunft ist der wichtigste Schritt dazu.
Quellen: Peter Fuchs, Land schafft Leben; Dr. Thomas Guggenberger, HBLFA Raumberg-Gumpenstein
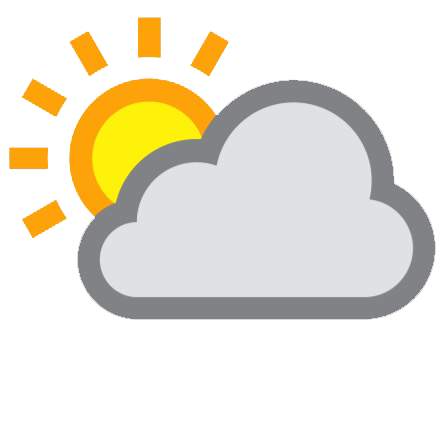
Über 160.000 Mitglieder nahmen auch heuer unsere Bauernbund-Agrarwetterhotline in Anspruch. Ab Anfang April steht euch dieses Service wieder zur Verfügung.
In unserem Imagefilm und der Infobroschüre erfahren Sie mehr über Ursprung, Aufgaben, Ziele und die Bedeutung des Tiroler Bauernbundes.
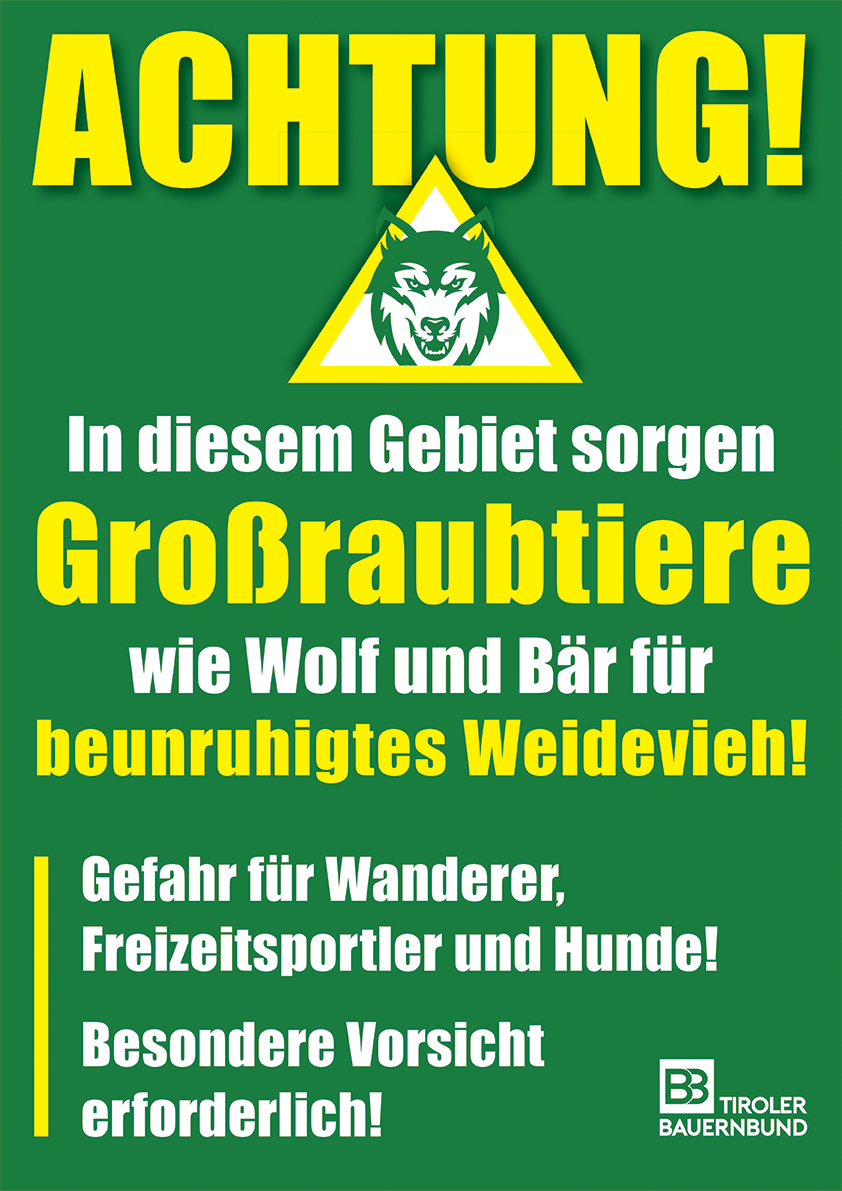
Bestellungen unter tbb@tiroler-bauernbund.at bzw. telefonisch unter +43 512 59 900-12
Für Bauernbund-Mitglieder: 20 Euro inkl. Versand | Für alle anderen: 30 Euro exkl. Versand
Die einfache Suche nach Personen, Orten, Dingen und Terminen!
Tiroler Bauernbund · Brixner Straße 1 · 6020 Innsbruck | +43 512 59 900-12 | tbb@tiroler-bauernbund.at
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr